KOLUMNE
Die Karl-Kolumne ergänzt die Printausgabe des Karl. Die Kolumne präsentiert Rezensionen aktueller und alter Schachbücher, Betrachtungen über die Literatur, Kultur und Psychologie des Schachs und gelegentliche Kommentare zum aktuellen Schachgeschehen.
ZWEI LITERARISCHE BEGEGNUNGEN
Henning Mankells Vor dem Frost und Walter Tevis‘ The Queen Gambit
Von FM Johannes Fischer

Henning Mankell,
Vor dem Frost,
Wien: Paul Zsolnay Verlag 2003, 540 S.,
24,90 Euro
Henning Mankells Vor dem Frost
Schachspielern in der Literatur oder in Filmen zu begegnen ist nicht immer ein Vergnügen. Oft behaupten sie fünfzig Züge im Voraus berechnen zu können und 100.000 Varianten im Gedächtnis zu haben, aber kennen die Namen der von ihnen gespielten Eröffnungen nicht. In Filmen bauen sie das Brett falsch auf und nehmen die Figuren in die Hand wie ein Nichtraucher eine Zigarette. Von Lasker, Capablanca und Aljechin reden sie wie ein Philosophiestudent im ersten Semester über Heidegger und Wittgenstein. Ihre Kenntnis der Schachgeschichte endet in der Regel kurz vor dem Zweiten Weltkrieg – es sei denn, sie sprechen über Fischer. Angenehme Zeitgenossen unter ihnen gibt es kaum. Die Sensiblen sind verrückt oder werden es bald und die robusteren Naturen nutzen ihren Verstand meist zur Planung perfider Verbrechen.
Besonders traurig stehen sie da, wenn ihnen jede Größe fehlt. Wie Zacharias aus dem neuen Roman Vor dem Frost des schwedischen Bestsellerautors Henning Mankell. In diesem von Fans in der ganzen Welt sehnsüchtig erwarteten Buch fahndet die von Mankell geschaffene Kultfigur Kommissar Kurt Wallander nach religiösen Fanatikern und verschwundenen Personen. Begleitet wird er von seiner Tochter Linda, der eigentlichen Hauptfigur des Romans. Sie möchte in die Fußstapfen ihres Vaters treten und Polizistin werden.
Bei ihren Ermittlungen trifft Linda Wallander etliche unappetitliche und kuriose Gestalten: den zum Obdachlosen verkommenen Sohn eines reichen norwegischen Reeders, religiöse Führer, die ihre eigenen Anhänger opfern, eine Frau, die Musik komponiert, die niemand hören will, und ein junges Mädchen mit Kette zwischen Ohr und Nase, die Linda plausibel ihren Fahrplan zur ersten Million darlegt. Von all diesen Figuren ist der Schachspieler Zacharias eine der unangenehmsten: „Sein Gesicht war voller Pickel. Er trug Jeans, ein Unterhemd und einen großen braunen Bademantel mit Löchern. Linda nahm seinen Schweißgeruch wahr. … Es schauderte sie, als er ihr eine schlappe und schweißfeuchte Hand hinhielt. … Sein Blick war lüstern. … Er lächelte. Dabei öffnete er den Mund und zeigte zwei Reihen gelber Zähne (Vor dem Frost, S. 210-212).“
Ganz ohne Wahnsinn geht es hier natürlich auch nicht. Im Laufe ihres Gesprächs verkündet Zacharias stolz: „‚Ich lese gerade eine Studie von Capablancas virtuosesten Endspielen. Manchmal glaube ich, es wäre möglich, eine Form zu finden, um Schachzüge mit Noten zu transkribieren. Dann wären Capablancas Partien wie Fugen oder große Messen.‘ Noch ein Irrer, der sich mit unspielbarer Musik beschäftigt, dachte Linda (S. 212).“
Warum treffen Kommissare eigentlich nie auf Schachspieler wie Capablanca – elegant gekleidet, höflich, gebildet, attraktiv und mit guten Manieren? Und welcher Schachspieler würde tatsächlich von einer „Studie von Capablancas virtuosesten Endspielen“ sprechen? Und warum sagt Zacharias eigentlich nicht so etwas wie: „Ich habe die ganze Nacht Blitzschach im Internet gespielt – mein Serverrating liegt jetzt knapp unter 2600“? Oder etwas arbeitsamer: „Ich hab‘ mir grad die neuesten Partien von TWIC heruntergeladen und überprüfe die Neuerungen mit Fritz“? Vielleicht erfordert ein solcher Satz aus Munde einer Nebenfigur mehr Kenntnisse der Schachspieler als man selbst von einem guten Autor wie Mankell verlangen kann.
Wie dem auch sei: Zacharias trägt nichts zur Klärung des Falles bei. Er erscheint, hinterlässt einen schlechten Eindruck, verschwindet wieder und weckt beim Leser wie bei Linda Wallander den Wunsch, man hätte ihn nie kennen gelernt. Man fragt sich, warum Mankell ihn überhaupt ins Spiel gebracht hat. Allerdings erörtert Vor dem Frost Fanatismus in seinen diversen Spielarten, den Fanatismus fundamentalistischer Sekten ebenso wie den Fanatismus von Kommissar Wallander beim Aufspüren von Verbrechern – und ein Schachspieler passt da gut ins Bild.
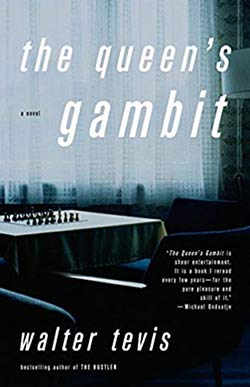
Walter Tevis,
The Queen’s Gambit,
New York: Vintage 1983, 243 S.,
11,25 Euro
WUNDERKIND, WAISE, ALKOHOLIKERIN
Walter Tevis‘ The Queen Gambit
Nach der unerwünschten Bekanntschaft mit Zacharias genießt man die Begegnung mit Beth Horman, der Protagonistin des 1983 erschienenen und kürzlich neu aufgelegten Romans The Queen’s Gambit von Walter Tevis. Als Schachwunderkind mit Alkohol- und Tablettenproblemen ist Beth ebenfalls eine extreme Figur. The Queen’s Gambit erzählt wie Beth‘ Schachtalent im Widerstreit mit ihren Selbstzweifeln, ihrer Einsamkeit und ihrem Gefühl mangelnder Geborgenheit liegt. Allerdings führt der Erfolg im Schach in diesem Roman nicht in den Wahnsinn und nicht ins soziale Abseits sondern symbolisiert die gelungene Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Beth Hormans Siege auf dem Schachbrett bedeuten Siege gegen ihre eigenen Ängste.
Walter Tevis hat ein Faible für Spieler und auch in seinem bekanntesten Buch The Hustler, das unter dem Titel Haie der Großstadt mit Paul Newman als scheiterndes Billard-As Eddie verfilmt wurde, geht es um Sieg oder Niederlage im Leben und im Spiel. Und wie Eddie in Haie der Großstadt muss Beth Horman die Frage beantworten, was sie aus ihrem Talent und ihrem Leben macht, ob sie ein Sieger- oder ein Verlierertyp ist.
Ihre Ausgangssituation ist schlecht: Ihren Vater kannte sie kaum und als sie acht ist, stirbt ihre Mutter. Beth kommt ins Waisenhaus. Dort stellt man die Kinder mit Medikamenten ruhig und diese Beruhigungsmittel bilden den Grundstein für Beth‘ spätere Alkohol- und Tablettensucht. Trost findet Beth nur im Schach, das sie durch Zufall von dem mürrischen Hausmeister lernt. Bald studiert sie Modern Chess Openings mit religiöser Inbrunst. Im Kopf, nachts, im Schlafsaal des Waisenhauses.
Der bedrückenden Atmosphäre des Waisenhauses entkommt Beth, als sie von Familie Wheatley adoptiert wird. Aber die Hoffnung auf Geborgenheit erweist sich als trügerisch. Nicht lange nach der Adoption verlässt Mr. Wheatley Frau und Adoptivtochter und bald sucht Mrs. Wheatley Halt in Alkohol, flüchtigen Männerbekanntschaften und Tagträumereien.
Währenddessen entdeckt Beth das Turnierschach. Ihr Talent ist gewaltig und ihr Aufstieg rasant. Bald gehört sie zu den besten Spielern der USA und ziert die Titelseiten von Schachzeitschriften. Mit dem Geld, das sie bei Turnieren gewinnt, können Beth und ihre Adoptivmutter den Lebensunterhalt bestreiten. Aber die Selbstzweifel kann sie weiterhin nur mit Alkohol und Tabletten betäuben.
Beth‘ Komplexe bündeln sich in ihrer Angst vor einer Niederlage gegen den Russen Borgov, einem der besten Spieler der Welt. Tatsächlich spielt sie in der ersten Partie gegen ihn verkrampft und verliert schnell.
Nachdem ihre Adoptivmutter stirbt, verliert Beth weiter Halt und versinkt in einem Dämmerzustand aus Gin Tonic, Wein, Bier und Tabletten. Die Frage, was Beth aus sich, ihrem Talent und ihrem Leben macht, stellt sich nachdrücklicher denn je. Die von Tevis angebotene Lösung ist ur-amerikanisch: Mit Hilfe von außen, aber vor allem durch den eigenen Willen kann der oder die Einzelne die eigene Bestimmung im Leben entdecken und sein Glück machen. Bei Beth kommt die Hilfe durch Jolene, eine alte Freundin und Rivalin aus dem Waisenhaus.
Jolene ist schwarz, gut aussehend und etwas älter als Beth. Und sie ist ein Siegertyp. Weil sie gut Volleyball spielt, konnte sie nach der Entlassung aus dem Waisenhaus mit Hilfe eines Stipendiums Sport studieren. Aber Jolene will mehr und so absolviert sie neben ihrer Arbeit als Sportlehrerin ein Studium der Politikwissenschaft, um besser für die Rechte der Schwarzen kämpfen zu können. Jolene bringt das Schachtalent wieder auf den Pfad der Tugend: sie verordnet Beth ein anspruchsvolles Fitnessprogramm, und bald hat Beth ihre Alkohol- und Tablettensucht im Griff. Auch im Schach findet sie rasch zur alten Form zurück. Sie ist bereit, sich ihren inneren Dämonen zu stellen und fährt zu einem Turnier nach Moskau, in dem sie auf Borgov und andere russische Schachgrößen trifft.
In der Partie zwischen Beth und Borgov kommt es zum Showdown. Der Kampf wogt hin und her, bis die Partie abgebrochen wird. Borgov kann die Hängepartie mit Petrosjan und Tal analysieren, während Beth allein ist. Doch ein überraschender Anruf ihres ehemaligen Trainers und Freundes Benny, der eine viel versprechende Fortsetzung entdeckt hat, zeigt Beth, dass auch sie nicht allein ist. Beth gewinnt die Partie und das Turnier.
Ein Happy-End im Schachroman, das gibt es selten. Aber warum hinterlässt The Queen’s Gambit trotzdem ein zwiespältiges Gefühl? Ist es die bei aller Spannung manchmal naive Darstellung des Spiels? So wirkt es zwar vertraut, wenn sich Beth nach unerwarteten und starken Zügen ihrer Gegner der Magen zusammenzieht und sie Aggressionen gegen ihre Gegner entwickelt; und auch die von Tevis entworfenen Porträts der Schachspieler und ihrer Manierismen erinnern an Figuren, die man bei jedem größeren Open trifft. Aber demgegenüber stehen Beschreibungen von Partien, in denen es vor allem wichtig zu sein scheint, möglichst viele Eröffnungsvarianten richtig zu erinnern und zu wissen, dass man jetzt gerade die Löwenfisch-Variante spielt. Merkwürdig abstrakt bleibt auch die Darstellung der Turnierszene in Amerika, in der Beth‘ nach ein paar Erfolgen in offenen Turnieren bereits als amerikanische Meisterin gehandelt wird.
Oder ist es Tevis‘ nicht immer überzeugende Zeichnung der Charaktere, die oft willkürlich wirkt, z.B. wenn Mrs. Wheatley plötzlich stirbt oder wenn Beth innerhalb kürzester Zeit zur Alkoholikerin mutiert und sich ebenso schnell davon befreien kann? Von der holzschnittartigen Darstellung russischer Schachspieler, die alle gut gekleidet sind und mindestens einmal Weltmeister waren, einmal abgesehen. Kurios wirkt auch das Auftauchen von Tal und Petrosian als geheimnisvolle Helfer Borgovs bei Hängepartien – um so mehr, da Walter Tevis im Vorwort erklärt, warum er auf Rollen für Fischer, Spasski und Karpow verzichtet hat: „Das brillante Schach von Großmeistern wie Robert Fischer, Boris Spasski und Anatoli Karpow ist für Spieler wie mich seit Jahren eine Quelle des Vergnügens. Aber da The Queen’s Gambit ein Roman ist, schien es angeraten zu sein, sie aus der Liste der Charaktere zu streichen, wenn auch nur, um Widersprüche mit der Wirklichkeit zu vermeiden.“
Ungenauigkeiten wie diese trüben das Vergnügen an The Queen’s Gambit – obwohl der Roman wirklich lesenswert ist. Aber man fragt sich, wie eine Figur wie Beth Horman von einem Autor wie Mankell behandelt worden wäre – wenn er sich denn zu etwas mehr Recherche in der Schachwelt hätte bequemen können. Vielleicht wäre endlich ein spannender, anspruchsvoller und realistischer Schachroman geschrieben worden.
