EINE RUHIGE HAND IN STÜRMISCHER SEE
Von Harry Schaack
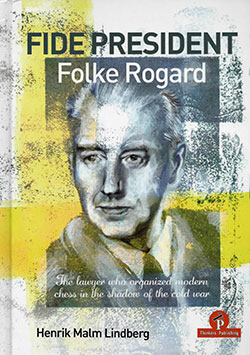
Henrik Malm Lindberg,
FIDE President Folke Rogard,
Thinkers Publishing 2024,
Hardcover, 336 S., 49,95 Euro
(Das Rezensionsexemplar wurde freundlicherweise von Schach Niggemann zur Verfügung gestellt.)
Der zweite Präsident der Fide war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des modernen Schachs, wie Henrik Malm Lindberg, ein Wirtschaftsprofessor, in seiner umfangreichen Biografie über Folke Rogard schreibt. Der Autor recherchiert dabei nicht nur akribisch das Leben von Rogard, sondern vor allem die Entwicklung der Fide sowie des Weltschachs nach dem Zweiten Weltkrieg. Erstmals konsultierte der Autor bislang unbenutzte Quellen, die in Archiven des Schwedischen Schachverbandes liegen und sprach mit Familienangehörigen Rogards. Dadurch entsteht durch seine Schilderungen ein lebendiges Bild der Geschehnisse, die sich hinter den Kulissen einer von vielen Wirren gekennzeichneten Zeit ereigneten.
Folke Rogard wuchs in Stockholm auf, wo er ein Jurastudium absolvierte, was damals der Eintritt in die höhere Gesellschaft war. Er knüpfte schon während seines Studiums, in dem er bereits einige Funktionärsämter begleitete, viele Kontakte, die er später zu einem Netzwerk ausbaute. Rogard war dreimal verheiratet, wobei seine erste Frau die Tochter des Direktors des Nobelpreiskomitees war, wodurch sich ebenfalls Verbindungen zu wichtigen Personen ergaben, auf die er später als Fide-Präsident zurückgreifen konnte.
Nach seinem Studium führte Rogard eine erfolgreiche Anwaltskanzlei. Eigentlich hieß er Rosengren, änderte seinen Nachnamen aber zu Rogard, weil es mehrere gleichnamige Juristen in Stockholm gab – und nicht, wie oft kolportiert, wegen seines Bruders, der wegen Unterschlagung und Betrug zu mehrjähriger Haft verurteilt wurde, wie der Autor meint.
Mit 40 Jahren zählte Rogard zu den Personen mit den höchsten Einkommen in Stockholm. Zwar spielte er schon in seiner Jugend, kam aber erst zu jener Zeit wieder zurück zum Schach, als man ihn zu den Vorbereitungen der Schacholympiade 1937 in Stockholm hinzuzog. 1939 wurde er Vorsitzender des Stockholmer Schachverbandes, wo er sich einen Namen als Organisator machte.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nahm Rogards Funktionärskarriere richtig Fahrt auf. Ab 1947 stand er auch dem Schwedischen Schachbund vor. Aber vor allem das Interzonenturnier in Saltsjöbaden 1948 war für Rogard ein entscheidender Moment für sein internationales Renommee. Gelder waren nach dem Krieg knapp, die Verbandkassen leer und einige Teilnehmer mussten absagen, weil sie die Reisekosten nicht tragen konnten. Deshalb unterstützte Rogard, der für die Organisation des Turniers verantwortlich war, einige Spieler aus eigener Tasche – wie er es auch zu anderen Gelegenheiten tat, z.B. mit den schwedischen Spielern Stoltz und Ståhlberg, aber auch bei vielen
Turnieren, die ohne seine persönliche Unterstützung nicht zustande gekommen wären. So konnte Schweden 1950 überhaupt erst dank Rogards privaten finanziellen Engagements ein Team zur Olympiade schicken.
Unter Rogards Führung übernahm sein Heimatland eine Hauptlast hinsichtlich der Organisation von Fide-Turnieren. Zwischen 1948 und 1963 fanden vier der fünf Interzonenturniere – und dazu noch zwei Studentenolympiaden und eine Junioren-WM – in Schweden statt.
Nach 1945 veränderte sich die Rolle der Fide vollständig und erforderte eine Neuausrichtung. Der Holländer Alexander Rueb, der die Geschicke der Fide seit ihrer Gründung 1924 geleitet hatte, war dafür nicht mehr der richtige Mann. Rogard, der aus dem im Zweiten Weltkrieg neutralen Schweden kam, war die ideale Besetzung für eine grundsätzliche Reformierung des Verbandes. Allerdings leitete er dieses Amt als starke Führungsperson, als pragmatischer „Macher“. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger pflegte er engen Kontakt zu den Spitzenspielern. Für demokratische Machtverteilung oder Kritik hatte er wenig Verständnis. Doch durch sein charismatisches, meinungsstarkes Auftreten und eigenen finanziellen Spielraum war er der Richtige für eine Zeit, in der sich die Welt neu finden musste und in der sich ein internationaler Konflikt an den anderen reihte.
Der Autor zeichnet die schwierigen Verhandlungen nach, die 1947 zum Fide-Beitritt der Sowjetunion führten. Die UdSSR traute dem Weltschachverband lange nicht zu, als neutraler Organisator zu fungieren. Doch die neuen Aufgaben des Weltschachverbandes reduzierten sich nicht nur auf die unvermeidlichen, durch den Kalten Krieg geprägten Konflikte. Als in Dubrovnik 1950 die erste Schacholympiade nach dem Krieg unter der Ägide des 1949 gewählten Rogard stattfand, boykottierten mit der UdSSR alle Ostblockstaaten die Veranstaltung, weil Jugoslawien unter Tito einen eigenen kommunistischen Weg gegangen war. Vier Jahre später bei der Schacholympiade 1954 fehlte die USA. Weil der ursprüngliche Ausrichter Buenos Aires wegen finanzieller Probleme absprang und kurzfristig Amsterdam die Organisation übernahm, waren dem US-Verband zu hohe Kosten entstanden. Aber auch die „deutsche Frage“, also wie man mit Spielern des Nationalsozialismus umgehen sollte, beschäftigte den Weltschachverband ebenso wie später die Apartheid in Südafrika und ähnliches.
Doch nach dem Tod sowohl des amtierenden Weltmeisters Aljechin 1946 als auch der besten Frau der Welt, Vera Menschik, die 1944 in London Opfer eines V1-Bombenangriffs wurde, war mit dem Beitritt der UdSSR für die Weltschachorganisation endlich der Weg frei, Weltmeisterschaften für beide Geschlechter mit adäquaten Qualifikationsturnieren zu etablieren. Dazu kamen die Ausrichtung der Olympiaden und die neu eingeführten Titelvergaben. Ferner dachte man schon seit den 50er Jahren über ein internationales Ratingsystem nach. Doch erst nach zehn Jahren konkreter Vorbereitung führte die Fide nach etlichen Gesprächen 1970 auf dem Fide-Kongress in Siegen die Elo-Zahlen ein, wobei Rogard bis zum Schluss skeptisch war, ob das Unterfangen gelingt.
Lindbergs Buch gibt auch Einblick, wie schwierig es für Turnierveranstalter zuweilen war, Spieler zu kontaktieren. Meist lief der Kontakt über die Verbände, die aber nicht immer sofort antworteten, sodass gelegentlich Rogard selbst die Spieler anrufen musste. Zudem waren bis zum Ende seiner Amtszeit Visaprobleme ein durchgängiges Ärgernis bei der Organisation von Turnieren. Wegen der politischen Verwerfungen waren häufig diplomatische Gespräche der Fide mit Regierungsbehörden notwendig. Dass die USA, die die DDR nicht als Staat anerkannten, 1960 in Leipzig bei der Olympiade spielten, war z.B. Rogards Verdienst.
Ein weiteres Problem war Bobby Fischer, dem sich Rogard persönlich annahm und den er von jungen Jahren an unterstützte, weil der US-Verband den Teenager zunächst nicht finanzierte. Doch als Fischer 1967 das Interzonenturnier in Sousse abbrach und ihm Rogard danach mit einem juristischen Nachspiel drohte, war das Verhältnis beider zerstört.
Als Rogard sein Amt 1970 auf dem Kongress in Siegen Euwe übergab, hatte sich die Fide enorm vergrößert. Bei der Schacholympiade 1950 in Dubrovnik waren 16 Länder am Start, in Siegen waren es 60 aus allen Kontinenten. Erst in den 20 Jahren unter Rogards Leitung war die Fide eine wirkliche Weltorganisation geworden.
Aber Anfang der siebziger Jahre wirkte Rogards autoritärer Führungsstil wie aus der Zeit gefallen. Einige Weggefährten warfen Rogard wegen seiner eigenständigen Entscheidungen sogar einen diktatorischen Führungsstil vor. Mit dem Wachsen der Mitgliederzahl wurden Stimmen immer lauter, die Verantwortung auf viele Schultern demokratisch zu verteilen.
Es mag sein, dass Rogard mit seinen über 70 Jahren auch amtsmüde war, wie Autor Lindberg glaubt. Vermutlich hatte ihn der Tod vieler Weggefährten in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre bestärkt, das Amt abzugeben. Rogard, der während seiner gesamten Amtszeit seine Kanzlei weiterführte, trug sich seit Anfang der sechziger Jahre immer wieder mit Rücktrittsgedanken.
In seinen letzten Jahren zog sich Rogard aus der Öffentlichkeit mehr und mehr zurück. Er starb 1973 nach einem Schlaganfall.
Lindbergs vorzüglich recherchierte Werk zeichnet nicht nur en détail die Ereignisse der von der Fide veranstalteten Turniere nach, sondern erinnert auch daran, dass die Führungsrolle eines internationalen Verbandes stets ein politisches Amt war, das diplomatisches Fingerspitzengefühl verlangte. Das galt damals wie heute.
