Der folgende Beitrag ist nur online verfügbar –
sozusagen eine Bonuslektüre zum Literatur-Heft 1/2010.
Dieser hier erstveröffentlichte Text
ist urheberrechtlich geschützt und
darf nur mit schriftlichem Einverständnis
des Autors weiterverwendet werden.
KAMPS SKURRILE STRATEGIE
Eine Schacherzählung
von Juan Oyarzún
An einem sonnigen Nachmittag gegen Ende Oktober kam ich wieder in meiner Geburtsstadt an. Dort, an der südlichen Westküste Südamerikas, erfreute man sich bereits eines fortgeschrittenen Frühlings, und Alleen, Parks und Gärten in voller Blüte waren mit ihrem Duft und ihrer Farbenpracht ein wahrer Genuss. Ich hatte ein Jahr in Paris verbracht, wo ein Stipendium mir die Vertiefung meines Studiums der französischen Sprache und Literatur an der berühmten Sorbonne ermöglicht hatte.
Meiner Schwester Marion war es wegen einer wichtigen Klausur nicht möglich gewesen zur Landungs-Brücke zu kommen, um mich zu empfangen. Das langweilige Warten am Zoll und die peinlich genaue Kontrolle kosteten mich drei Stunden. Ein Taxi fuhr mich mit meinen zwei großen Koffern zum Studentenheim, in dem ich während meines Studiums vor meiner Reise gelebt hatte. Marion wohnte in einem anderen Studentenheim, da sie an der technischen Universität seit fünf Jahren Physik studierte.
Herr Remberto Ortiz, der Verwalter des Heims, kannte mich und war von meiner Rückkehr benachrichtigt worden. Er begrüßte mich herzlich und ließ einen Diener herbeirufen, der sich um mein Gepäck kümmern sollte. Während wir in der Eingangshalle auf ihn warteten, sagte er mir, dass ich in einem größeren Zimmer im sechsten Stock wohnen würde; alle Zimmer des Heims seien jetzt mit Klapp-Betten ausgestattet und der so resultierende Platzgewinn habe die Aufstellung einer kleinen, aber gemütlichen Sitzgarnitur ermöglicht.
Anderthalb Stunden später, als die wenigen Wolken am westlichen Himmel sich in der Abenddämmerung allmählich rot färbten und ich mit Auspacken beinahe fertig war, ist meine Schwester angekommen. Noch nie waren wir so lange getrennt gewesen und dementsprechend ist unsere Begrüßung herzlich und freudig ausgefallen. Wir fuhren hinunter zum Erdgeschoß, stärkten uns im dortigen Casino mit einem Imbiss und kehrten in mein Zimmer zurück, um ein paar Stunden gemütlich zu plaudern. Dort, während wir uns gegenüber saßen, jeder mit einem guten Tropfen in Reichweite, fiel mir Marions Blässe auf, die von ihrem schwarzen Haar eingerahmt, noch hervorgehoben wurde.
„Du siehst nicht gut aus“, sagte ich ihr. „Du bist blass und hast ein wenig abgenommen. Hast du Sorgen? Ist alles in Ordnung mit dem Physikstudium?“
Marion lächelte und winkte ab. Immer wenn sie lächelte bildeten sich zwei Grübchen auf ihren Wangen.
„Nichts von Bedeutung“, erwiderte sie. „Nur eine Sache der letzten Wochen. Aber ich hatte auf jeden Fall die Absicht, es mit dir zu besprechen, um zu wissen, was du davon hältst. Du bist rechtzeitig zurückgekehrt.“
„Rechtzeitig inwiefern?“
„Mitte September wurden die internen Schachmeisterschaften an unseren Universitäten beendet. Dieses Jahr habe ich wieder daran teilgenommen. Wie du weißt, musste ich letztes Jahr darauf verzichten, weil ich krank wurde. Dieses Mal bin ich Siegerin geworden.“
Um das Interesse der Studenten fürs königliche Spiel zu fördern, waren beide Universitäten unserer Stadt, die private technische und die staatliche, vor langer Zeit übereingekommen, jedes Jahr ein internes Schachturnier zu veranstalten. Die beiden Finalisten traten gegeneinander an und kämpften um den vom Rathaus gestifteten Pokal. Dieser jährliche Zweikampf wurde im Laufe der Jahre Universitätsklassiker genannt und zog jedes Mal sowohl Studenten als auch Dozenten in seinen Bann. Leider wurde diese ausschlaggebende Begegnung wegen Geld- und Zeitmangels nach dem Knockout-System ausgetragen, das heißt sie wurde durch eine einzige Partie entschieden, was viele, darunter auch Marion und ich, missbilligten, weil wir dies als ungerecht ansahen. Bekanntlich ist im Schach wegen des Glückfaktors keineswegs unmöglich, dass der schwächere Spieler auch einmal einen ihm überlegenen Gegner bezwingen kann.
Trotz dieses Handicaps hatten meine Schwester und ich, beide begeisterte Schachspieler schon als Kinder, seit Beginn unserer Studienzeit an den internen Wettbewerben teilgenommen. Mir war schon lange bewusst, dass Marion mir weit überlegen war. Sie war ein Talent, was ihre Leistungen auf der Turnierarena unzweifelhaft bestätigten. In den ersten drei Jahren war Marion jedes Mal Vize-Meisterin im internen Turnier ihrer Universität geworden, während ich in der staatlichen „Alma Mater“ je nach Jahr mit etwa dem zehnten bis zum zwölften Platz hatte vorlieb nehmen müssen. Ich hatte ihre Begabung anstandslos anerkannt, begnügte mich damit, sie als guten Sekundanten zu unterstützen und freute mich jedes Mal über ihre Erfolge in einer Zeit, in der in unserem Land Schach spielende Frauen als Sonderlinge galten. Ich bedauerte nur, dass sie während der drei ersten Jahre nur zweite geworden war, weil ein gewisser Aguilera zweimal und ein gewisser Lobos einmal nach Punkten knapp besser als sie die Turniere beendet hatten. Und jetzt überraschte sie mich mit der Mitteilung, dass sie dieses Mal Siegerin geworden war!
„Großartig, Marion, prächtig! Meinen herzlichen Glückwunsch!“, rief ich begeistert. Und mich ihr oberhalb des Tisches zuneigend, packte ich sie bei den Schultern und küsste die beiden Grübchen auf ihren Wangen, denn sie lächelte wieder.
„Danke, Nico, vielen Dank“, sagte sie. „Ich wusste, dass du dich freuen würdest.“
Ich heiße Nicolás, aber sie nannte mich Nico seit unserer Kindheit.
„Selbstverständlich freue ich mich“, sagte ich, indem ich mich wieder setzte. „Aber … wo ist dann das Problem?“
„Quintal hat das Turnier eurer Universität wieder gewonnen.“
Quintal war ein Student der Wirtschafts- und Handelswissenschaften an unserer staatlichen Universität, der so wie Marion ein besonders talentierter Spieler war, besonders talentiert im Rahmen der Universitätsturniere versteht sich. Seit seinem ersten Studienjahr war er, sein jetziger Sieg mitgerechnet, sechs Jahre hintereinander interner Meister geworden, und hatte bisher fünfmal den Zweikampf gegen die jeweiligen Finalisten der technischen Universität gewonnen, denn weder Aguilera noch Lobos noch ihren Vorgängern war es gelungen, ihm den vom Rathaus gestifteten Pokal auch nur einmal zu entreißen. Ob das keine ungewöhnliche Schachleistung ist! Somit war die staatliche Universität fünf Jahre in Folge die Gewinnerin des Schach-Klassikers gewesen, und Quintal genoss beinahe den Ruf eines Helden. Ich hatte wenig direkt mit ihm zu tun gehabt, weil er in einer anderen Fakultät studierte, aber als Teilnehmer des internen Turniers hatte ich seine Leistungen miterlebt. Auch hatte ich gehört, dass er ein schlechter Gewinner sein sollte; das heißt, anmaßend und großmäulig in Bezug auf seine Siege. Jedoch hatte ich diese Gerüchte für üble Nachrede mancher seiner unterlegenen Gegner gehalten.
Durch meine einjährige Abwesenheit und die dadurch bedingte Ablenkung hatte ich von den Ereignissen in Zusammenhang mit dem Universitätsklassiker Abstand gewonnen. Was meine Schwester mir eben mitgeteilt hatte, bedeutete, dass sie als neue Meisterin der technischen Universität gegen Quintal, den fünfmaligen Sieger, anzutreten hatte, um ihm den Pokal streitig zu machen. Dies rechtfertigte ihre Sorge, aber nur zum Teil, meiner Ansicht nach.
„Ich verstehe“, sagte ich ihr. „Du musst jetzt gegen ihn um den Pokal spielen. Ist das dein ganzes Problem? Aber Marion … ich kenne dich als gute Verliererin. Quintal ist ein ausgezeichneter Spieler. Es ist keine Schande gegen ihn zu verlieren.“
„Verlieren ist nicht mein Problem, sondern gegen Quintal verlieren.“
„Warum? Wie soll ich das verstehen?“
„Quintal ist ein eingebildetes Großmaul, eitel, anmaßend und selbstgefällig, der mit seinen Erfolgen prahlt und Frauenschach gering schätzt … und hat keine Skrupel es auszuposaunen. Ich habe erfahren, dass er, als er von meinem Sieg im internen Turnier hörte, gesagt hat, dass dieser mehr auf die schlechte Verfassung Aguileras als auf mein schachliches Können zurückzuführen sei.
Aguilera war dieses Mal zweiter.
Quintal gönnt mir meinen Sieg nicht! Er ist mir zuwider! Ich will nicht gegen einen so überheblichen Typ verlieren! Das wäre wie Öl ins Feuer gießen!“
Marion hatte ihre letzten Sätze so eindringlich ausgesprochen, dass ich staunen musste. Ich kannte meine Schwester als heiteren, umgänglichen und ausgeglichenen Menschen, der nicht leicht aus seinem Gleichgewicht geraten konnte. Der bevorstehende Zweikampf gegen Quintal ließ ihr wirklich keine Ruhe.
„Und was willst du jetzt tun?“ fragte ich sie. „Quintal ist dir ohne Zweifel deutlich überlegen.“
„Ich habe mich während der vergangenen Wochen mit seinen Schachpartien befasst und glaube, einen Weg gefunden zu haben, um meine Aussichten ihn zu schlagen wesentlich zu erhöhen.“
Es lag nicht in Marions Art, leichtsinnige, unüberlegte Behauptungen von sich zu geben. Wenn sie so etwas sagte, wusste ich, dass es richtig durchdacht sein musste.
„Und welcher Weg ist das?“
„Quintal kennt sich in den Eröffnungen und ihren Varianten sehr gut aus. Die Endspieltechnik beherrscht er ebenfalls, und im Mittelspiel hat er ein ausgezeichnetes Auge für die korrekte Strategie. Aber er hat zwei Schwächen. Erstens: Er ist wenig flexibel. Ausgefallene Züge in der Eröffnung bringen ihn aus dem Konzept und er braucht dann Zeit, um die passende Antwort zu finden. Zweitens: Er neigt dazu, in Zeitnot zu geraten und findet deshalb manchmal in komplizierten Stellungen nicht den Schlüsselzug.“
Im Zimmer war es inzwischen halbdunkel. Ich schaltete die Tischlampe an und füllte unsere Weingläser nach. Draußen in der Ferne ertönte eine Schiffssirene.
„Deine Idee mit den ausgefallenen Zügen gleich in der Eröffnung ist nicht neu“, sagte ich. „Manche Großmeister haben sie mit Erfolg angewendet, erlitten damit aber meistens Schiffbruch, wenn ihre Gegner viel stärker waren. Du weißt, dass ausgefallene Züge in der Eröffnung deshalb ausgefallen sind, weil sie selten oder gar nicht gespielt werden, und warum das? Weil sie meistens bedenkliche Züge sind!“
„Ja, aber die vermeintlich bedenklichen Züge können sich als korrekt erweisen, wenn sie auf eine von vornherein bestimmte Strategie zielen. Mit anderen Worten … aufgrund der mir bekannten Schwächen Quintals könnte ich am Ende der Eröffnungsphase durch Änderung der Zugfolge eine korrekte Stellung erreichen und bereits einen Zeitvorteil zu meinen Gunsten haben.“
„Da hast du nicht ganz Unrecht, Marion. Aber wenn Quintal auf einen deiner ausgefallenen Züge die korrekte Antwort findet, und das ist ihm zuzutrauen, ist deine Stellung ein paar Züge später ein Scherben-Haufen. Da hilft dir kein Zeitvorteil weiter.“
„Das ist mir klar“, räumte meine Schwester ein, „aber dieses Risiko muss ich eingehen. Wenn ich völlig konventionell spiele, habe ich bei seiner Stärke kaum Chancen auf einen Sieg. Andererseits habe ich noch einen weiteren Faktor zu meinen Gunsten: den menschlichen Faktor! Quintal muss auf Sieg spielen. Alles andere wäre für ihn eine Blamage. Ich kann hingegen verlieren. Alle rechnen damit. Selbst wenn mir ein Remis gelingt und der Sieger nach unseren Turnierregeln durch eine Blitzpartie ermittelt werden sollte, ist das schon für ihn peinlich. Bisher hat er alle unsere Schachklassiker gleich gewonnen.“
„Wann soll euer Zweikampf stattfinden?“
„Mitte November, also in zwei Wochen.“
„Und wo dieses Jahr?“
„Bei uns, im Auditorium des Physikalischen Instituts. Ich werde die schwarzen Steine führen.“
Die Austragung des Universitätsklassikers erfolgte jedes Jahr abwechselnd in einer der beiden Universitäten. Um zu vermeiden, dass einer der Finalisten durch Zufall zwei- oder drei Jahre hintereinander mit derselben Farbe spielen musste, hatten die Organisatoren verabredet, dass der Spieler zu Gast immer die weißen Steine bekommen sollte.
„Hat Quintal irgendwelche Lieblingseröffnungen, wenn er mit Weiß spielt?“, fragte ich.
„Er fängt meistens mit dem Königsbauern an. Manchmal auch mit dem Königsspringer. Anders sehr selten.“
„Das erleichtert dir deine Vorbereitung, aber ich würde mich nicht darauf verlassen. Quintal mag ein Angeber sein, aber er ist nicht dumm. Er weiß, dass du ihm trotz seiner Überlegenheit gefährlich werden kannst. Du musst mit möglichen Überraschungen seinerseits rechnen. Ziehe in deinen Vorbereitungen auch andere Anfangszüge in Betracht.“
Nur zwei Wochen bis zum Zweikampf waren wenig Zeit, aber Marion hatte gleich nach ihrem Sieg im internen Turnier angefangen, sich für das Duell mit Quintal vorzubereiten. Vom Tag nach meiner Ankunft an, trafen wir uns jeden Abend entweder bei ihr oder bei mir und übten ein paar Stunden. Mehr Zeit konnten wir ihrem Training nicht widmen, weil wir beide tagsüber unseren Verpflichtungen als Studenten nachgehen mussten. Je mehr sich der Tag der Begegnung näherte, umso mehr setzte dies Marion zu, trotz ihres fröhlichen Charakters. Ich machte mir schon Sorgen um sie. Ich kannte einen anderen Studenten gut, einen schlaksigen jungen Kerl namens Pereira, der wie Quintal ebenfalls Wirtschaftswissenschaften studierte und deshalb in demselben Casino speiste wie er. Ich wusste, dass ich mich auf ihn verlassen konnte und bat ihn, ein paar Tage wie zufällig in Quintals Nähe zu sitzen und versuchen zu hören, was für Kommentare er zum bevorstehenden Zweikampf gegen meine Schwester von sich gab. Ich selber konnte es nicht tun, denn meine Anwesenheit im „gegnerischen Lager“ wäre den meisten Studenten sofort aufgefallen. Drei Tage vor dem Match traf ich mich mit Pereira auf der Seepromenade. Bekanntlich haben Mauern manchmal Ohren, und mit ihm deshalb telefonieren, wollte ich auch nicht. Während wir nebeneinander schlenderten, sagte er mir, dass Quintal einen gelassenen, selbstsicheren Eindruck vermittle. Von seinen Tischgenossen gefragt, ob er sich für die Begegnung mit Marion vorbereite, habe er geantwortet: „Ja, aber nicht mehr als im Falle meiner bisherigen Gegner.“
Wenn er sich für die Partie gegen Marion mehr Mühe gab als für die anderen Gegner, hätte er dies sowieso nicht zugegeben. Sein Ego ließ es nicht zu. Von dieser Seite hatte ich also nichts Neues erfahren. Meine Schwester wusste nichts von meinem Vorgehen. Sie hätte es rundweg missbilligt. Sie selbst war vorsichtig und verschwiegen. Ihrerseits von Freunden und Kommilitonen gefragt, ob sie sich für den Zweikampf gegen Quintal besonders vorbereite, hatte sie geantwortet, dass sie jeden Abend trainiere. Sonst nichts … also kein Wort über ihre geplante Strategie verloren.
So kam es an einem Samstag Mitte-November zum mit viel Spannung erwarteten Zweikampf der beiden Finalisten. Ich kam in das Physikalische Institut eine Viertelstunde vor Beginn an. Um einen Sitzplatz hatte ich mich nicht zu kümmern brauchen, weil jedem der Finalisten vier Plätze in der ersten Reihe für Freunde und Verwandten zustanden. In der Eingangshalle sah ich Marion von einer Gruppe aufgeregter Studenten und Studentinnen umringt, die auf sie einredeten. Sie hatte eine grüne, am Hals aufgeknöpfte Bluse an; dazu einen breiten, schwarzen Plisseerock und eine drollige kurze Weste, ebenfalls schwarz, die wie eine Verlängerung ihres schulterlangen Haares wirkte. Hübsch und adrett sah sie aus.
Ich bahnte mir einen Weg durch die Gruppe, umarmte Marion und wünschte ihr Hals- und Beinbruch. Dann betrat ich das Auditorium. Es umfasste etwa sechshundert Sitzplätze und war zum Bersten voll, was bisher bei den Zweikämpfen der Finalisten nie der Fall war. Außerdem fiel mir auf, dass im Publikum, vorwiegend junge Menschen, Frauen deutlich in der Mehrheit waren. Das war ebenfalls etwas Neues. Die Tatsache, dass dieses Mal eine Frau die Gegnerin des langjährigen Siegers des Universitätsklassikers war, hatte offensichtlich immenses Interesse geweckt, und zwar nicht nur in Schachkreisen, sondern auch unter denjenigen Damen, die sich sonst nie für Schach interessierten. Andererseits hatte die Presse, meistens mit einem guten Riecher fürs Geschäft, in den vorhergehenden Tagen genügend für Rummel und Sensation gesorgt.
Ich ging durch den Mittelgang nach vorne und nahm Platz rechts in der ersten Reihe. In derselben Reihe links vom Mittelgang sah ich Quintal, der vor seinen sitzenden Eltern stand, neben ihm eine mir unbekannte junge Frau mit kupferfarbiger, hochgesteckter Haarpracht. Quintal trug einen pastellfarbigen Sommeranzug, einen von den damals so genannten Palm Beach Anzügen. Sein längliches, kantiges Gesicht war ein wenig sonnengebräunt, und sein blondes Haar lag sorgfältig gekämmt und gescheitelt. Er schien guter Laune zu sein, denn er scherzte gerade mit seinen Verwandten. Auf dem Podium waren der Schachtisch und die Sessel bereits aufgestellt. Auf dem Tisch konnte man die geordneten Holzfiguren, die Schachuhr und die Partieformulare sehen. Hinten an der Wand hing ein großes Schild, auf dem die Worte standen: Universitätsklassiker – Duell der Finalisten, und rechts daneben war ein Demonstrationsbrett für alle sichtbar aufgehängt worden. Mit den darauf entsprechend großen magnetischen Schach-Figuren sollte ein Institut-Diener dem Publikum den Verlauf der Partie nahe bringen. Ebenfalls auf dem Podium vorne links war ein Ständer mit eingehaktem Mikrophon, und direkt vor dem Podium hatten sich die Mädchen und Jungen des Studentenorchesters der Musikakademie mit ihren Instrumenten eingerichtet.
Wenige Minuten nach mir kamen unsere eigenen Gäste an, Norma Wlassov mit ihrem Vater. Sie war eine lustige, etwas zurückhaltende Brünette, mit Marion seit ihrer gemeinsamen Gymnasialzeit befreundet. Sie studierte Biochemie ebenfalls an der technischen Universität. Ihre Eltern, ein eingewandertes russisches Tänzerpaar, betrieben eine Ballettschule für Kinder und Jugendliche. Ihr Vater war aktives Mitglied eines der Schachclubs unserer Stadt. Mit seiner Zwickbrille und seinen graumelierten Haaren und Kinnbart erinnerte er mich an Leo Trotzki. Wir begrüßten uns herzlich und ich musste Norma ein wenig necken, als ich merkte, wie aufgeregt sie war.
Fünf vor zwei hörte man die Rufklingel schellen und das Publikum begann zu applaudieren, denn vier Herren waren durch die hintere Tür hereingekommen und hielten jetzt paarweise durch den Mittelgang Einzug. Ich erkannte wieder die Rektoren beider Universitäten, unseren Oberbürgermeister Don Estanislao Soto, und unseren Internationalen Meister Don Fermín Marroig. Plötzlich wurde der Beifall erheblich lauter und einzelne Hurrarufe mischten sich ein. Ich schaute wieder nach vorne und sah Quintal, der gerade die Stufen der Seitentreppe zur Bühne bestieg. Gleichzeitig sah ich meine Schwester, die aufs Podium durch einen hinteren Kulisseneingang gelangt war, und jetzt auf den Schachtisch zuging. Quintal kam ihr entgegen und sie begrüßten sich höflich aber kühl mit einem Händedruck. Dann nahmen sie Platz auf den für sie bereitgestellten Drehsesseln am Schachtisch, aber dem Publikum zugewandt.
Der Oberbürgermeister, mit Amtskette am Hals, und seine Begleiter hatten sich inzwischen in die erste Reihe gesetzt. Punkt zwei Uhr begann die Begrüßungszeremonie. Der junge Dirigent stellte sich vor das Orchester und feierlich ertönte die Ouvertüre der Feuerwerk-Suite von Georg Friedrich Händel. Nach dem Ausklang und dem wohlverdienten Beifall bestieg der Rektor der technischen Universität, Professor Juvenal del Río, das Podium und hielt als Gastgeber eine kurze Begrüßungsrede. Er dankte dem Oberbürgermeister für seine Anwesenheit und seine Unterstützung. Danach stellte er dem Publikum die beiden Kontrahenten vor, worauf diese, die aufgestanden waren, sich für den Applaus jeweils mit einer Verneigung bedankten. Marion wurde zuerst vorgestellt, und dass der Applaus für sie wesentlich lauter ausfiel, war nicht zu überhören. Kein Wunder bei den vielen begeisterten Mädchen im Publikum! Der Rektor gab seine Genugtuung kund über die „erfreuliche Tatsache, dass zum ersten Mal eine Frau als Finalistin des internen Turniers ihrer Universität jetzt die Herausforderin des langjährigen Siegers Marcos Quintal war.“
Dann stellte er dem Publikum den Internationalen Meister Fermín Marroig vor, der die Rolle des Schiedsrichters übernommen habe, und bat diesen aufs Podium. Den Fotoreportern, die vor der Bühne wie um die Wette knipsten, teilte der Rektor mit, dass nach Beginn des Zweikampfes nicht mehr fotografiert werden dürfe. Und, last but not least, wie er sich ausdrückte, stellte der Rektor den Institut-Diener vor, der die Schachzüge aufs Demonstrationsbrett übertragen sollte. Dieser, ein feister junger Mann, saß bereits im Hintergrund direkt vorm genannten Brett.
Damit verließ Professor del Río das Podium und zwei Minuten später kam der Augenblick, auf den wir alle mit so viel Spannung gewartet hatten: Punkt halb drei ging Fermín Marroig zum Schachtisch und setzte Quintals Uhr in Gang. Die beiden Gegner tauschten den traditionellen Handschlag aus und ohne zu zögern schob Quintal seinen Damenbauern nach
1.d4!
Offensichtlich wollte er damit meine Schwester überraschen. Wie froh war ich, dass Marion sich auch auf diesen möglichen Anfangszug vorbereitet hatte, wenn auch weniger als auf jenen mit dem Königsbauern. Ebenfalls ohne zu zögern spielte sie
1…Sf6,
worauf innerhalb von wenigen Sekunden die Züge folgten:
2.Sf3 d6. 3.Lg5 h6 4.Lh4
und jetzt kam Marions erste Überraschung:
4…Lg4!
…. ein recht ungewöhnlicher Zug in dieser Stellung. Verwundert warf Quintal einen kurzen Blick seiner Rivalin zu; dann sah er wieder aufs Brett. Er konnte sich denken, dass Marion diesen seltsamen Läuferausfall genau überlegt hatte, was bedeutete, dass sie auf die Möglichkeit d4 als ersten Zug ihres Gegners vorbereitet war. Damit war seine eigene ausgedachte Überraschung fehlgeschlagen! Nachdem er für seine Antwort fast fünf Minuten gebraucht hatte, spielte Quintal
5.Sbd2,
worauf Marion prompt mit
5…g6
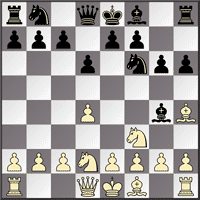
reagierte. Zweiter ausgefallener Zug! Wenn nichts dagegen spricht, zieht man hier gleich g5 und spart ein Tempo. Danach ging es weiter mit:
6.c3 Lg7 7.e4 0-0 8.Ld3 g5 9.Lg3 Sh5 10.Dc2 Sf4 11.Lxf4 gxf4 12.0-0-0 Sc6 13.h3 Lh5 14.g4 Lg6 15.h4 e5
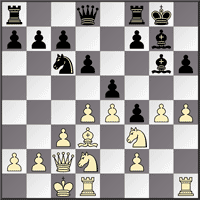
.
Beim fünfzehnten Zug angelangt stand Quintal etwas besser. Er hatte alle seine Figuren entwickelt, lang rochiert und jetzt einen Bauernsturm auf Marions geschwächte Rochade gestartet. Dies alles hatte ihn aber zwanzig Minuten mehr an Bedenkzeit gekostet. Zudem hatte er einen Läufer für einen Springer tauschen müssen, weil ihm Marions Springer als Vorposten auf dem Königsflügel zu lästig war. Meine Schwester hatte also weniger Bedenkzeit verbraucht und dazu den Vorteil des Läuferpaares, das jetzt die Rochade von Schwarz verteidigte. Keine schlechte Bilanz für ihre ersten fünfzehn Züge gegen den fünffachen Meister!
Mit den folgenden Zügen:
16.Tdg1 exd4 17.h5 dxc3 18.bxc3 Lh7 19.g5 Kh8
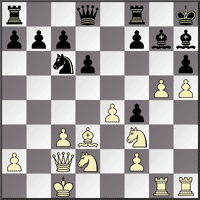
setzte Quintal seinen Bauernsturm fort, jetzt auch noch von seinem zweiten Turm auf der halboffenen g – Linie unter-stützt. Marion reagierte darauf mit einem Gegenangriff im Zentrum, der von ihrem e-Bauern geführt wurde. Dadurch gewann sie Zeit, um ihrem in die Enge getriebenen Damenläufer das Rückzugsfeld g8 zu verschaffen. Nach drei weiteren Zügen:
20.g6 fxg6 21.e5 Sxe5 22.Sxe5 dxe5
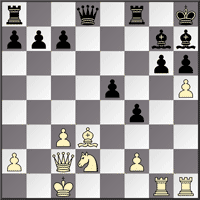
hatte sich die Lage zugunsten Marions geändert. Quintal hatte mit seinem Zug e5 die Sperrung der Diagonale b1 – h7 behoben und jetzt übten sein Läufer und seine Dame zusätzlichen Druck auf die Rochade seiner Gegnerin aus. Mit ihrem Springerzug hatte meine Schwester darauf gezielt, den gefährlichen weißen Läufer sogleich zu schlagen, aber Quintal hatte ihre Absicht erkannt und mit seinem Gegenzug gleich vereitelt. Trotzdem war es Marion gelungen, mit ihrem Angriff im Zentrum den Bauernsturm zu verzögern, zwei Bauern zu erobern und obendrein ihrem Gegner eine hässliche Lücke in seiner Rochade zu verpassen. Und ihr Läuferpaar hielt weiterhin Wache vor dem König!
Wie mir schien, war Quintal ungeduldig geworden. Mit den letzten vier Zügen hatte er seinen Stellungsvorteil eingebüßt und Marion verfügte über fast fünfundzwanzig Minuten mehr. Nach den Turnierregeln hatte jeder von ihnen zwei Stunden Zeit für die ersten vierzig Züge. Bisher hatte Quintal siebzig und Marion knapp fünfundvierzig Minuten Bedenkzeit verbraucht. Es war zu erwarten, dass er jetzt den Druck auf die Rochade seiner Rivalin erhöhen würde.
Es folgten die Züge:
23.hxg6 Lg8
Ich fühlte, dass Spannung im Auditorium aufkam. Auch ich wurde unruhig, von Norma und ihrem Vater ganz zu schweigen. Marion hatte ihr Läuferpaar noch nicht aufgeben müssen; andererseits sah Quintals Angriff, jetzt von beiden Türmen unterstützt und baldmöglichst auch von weiteren leichten und schweren Figuren verstärkt, bedrohlicher aus denn je. Würde meine Schwester ihn noch abwehren können?
Trotzdem machte Quintal einen verstörten Eindruck. Dass es ihm bisher nicht gelungen war, einen deutlichen Vorteil zu erringen, ärgerte ihn über allen Maßen.
Völlig unerwartet mussten wir auf seinen nächsten Zug lange warten. Wie versteinert starrte er aufs Schachbrett, sein angestrengtes Nachdenken nur hin und wieder von hastigen Blicken auf die Uhr unterbrochen. Fünf …. zehn … fünfzehn Minuten vergingen und nichts! Seine Uhr tickte und tickte. Marion stand auf, machte ein paar Schritte auf und ab auf dem Podium und setzte sich wieder. Zwanzig ..… fünfund-zwanzig Minuten und nichts!
“Jetzt kommt was!” flüsterte jemand hinter mir. “Er geht aufs Ganze!”
Nach fast einer halben Stunde traf Quintal seine Entscheidung und spielte:
24.Txh6+!
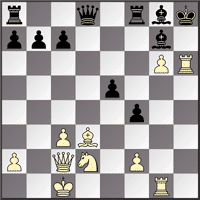
Ein lebhaftes Raunen ging durch den Saal und der Schiedsrichter musste um Ruhe bitten. Das Publikum ahnte, dass sich das Duell einem Höhepunkt näherte. Quintal versuchte, mit einem Turmopfer Marions Verteidigung zu brechen! Spätere Analysen der Stellung mit meiner Schwester und Herrn Wlassov zeigten uns, dass sein Opfer korrekt war. Nur, er hatte zuviel Zeit dafür verwendet. Die schwachen Züge kamen danach, durch seine Zeitnot bedingt.
Marion hatte dieses Opfer kommen sehen und ihren Zug darauf schon geplant. Sie antwortete mit:
24…Lxh6
Weiter ging es mit:
25.g7+ Lxg7 26.Th1+ Lh6
Es gab keine Alternative. Jetzt musste der treue Königsläufer mit erhobener Flagge für seinen König zugrunde gehen!
27.Txh6+ Kg7 28.Tg6+ Kh8 29.Lc4(?) Dh4!
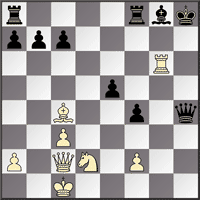
Erneutes Raunen im Saal zwang Schiedsrichter Marroig, seine Forderung um Stille zu wiederholen. Die Spannung nahm zu. Das zwar korrekte Turmopfer war durch den schwachen Zug 29.Lc4 ein Schlag ins Wasser gewesen. Quintal hatte es in der Hand gehabt, ein Remis durch Zugwiederholung zu erzwingen, aber, wie Marion es vorausgesehen, er wollte unbedingt gewinnen. Meine Schwester hatte nunmehr ihre Dame zur Verteidigung herangezogen, wodurch auch ihr bisher kaum aktiver Damenturm schnell ins Spiel eingreifen konnte. Jetzt war der schwarze Stellungsvorteil unübersehbar. Quintal konnte sich kaum noch beherrschen. Marions verbissener Widerstand, mit dem er nicht gerechnet hatte, machte ihn rasend. Einige blonden Strähnen lagen jetzt auf seiner vom Schweiß glänzenden Stirn, und er schien, wenig Luft zu bekommen, denn er hatte Kragen und Krawatte etwas gelockert. Marion erzählte mir später, dass sein linkes Augenlid begonnen hatte zu zucken. Ihm blieben nur noch drei Minuten für die nächsten elf Züge, seiner Gegnerin dagegen eine halbe Stunde.
Sie setzten ihren aufregenden Kampf fort:
30.De4 Tae8 31.Sf3 Dh1+ 32.Kb2 Lh7 33.Ld3 Te6 34.Tg1 Dh6
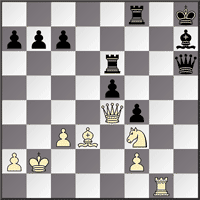
Meine Schwester hatte ihren Damenturm ins Spiel geholt, und mit dem Schach ihrer Dame auf das Feld h1 den weißen König in die halboffene b-Linie getrieben. Quintal seinerseits war die Umstellung seiner Dame und seines Läufers auf der Diagonale b1 – h7 gelungen, wodurch eine Mattdrohung auf dem Feld h7 entstanden war. Trotzdem hatte sich seine Lage weiter verschlechtert; Weiß stand auf Verlust. Und jetzt versuchte er mit einer Falle das Blatt doch noch zu seinen Gunsten zu wenden. Schnell nacheinander folgten die Züge
35.Dxh7+ Dxh7 36.Lxh7
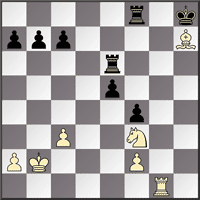
Marion zögerte. Hatte sie die Falle erkannt? Wegen der möglichen Springergabel auf g5 durfte sie den weißen Läufer nicht sofort mit ihrem König schlagen. Mir schien plötzlich, als hätten alle im Saal den Atem angehalten und es wäre nur noch das Ticken von Marions Uhr zu hören. Nach einer weiteren Minute, die uns unendlich lang vorkam, nahm sie ihren Damenturm und schob ihn behutsam von e6 nach b6.
36…Tb6+
Das war das Aus für Quintal. Nach
37.Kc2 Kxh7
und mit kaum noch einer Minute bis zur Zeitkontrolle, hätte er ohnehin auf verlorenem Posten gestanden. Sein Gesicht war rot vor Wut und Erbitterung. Für einen Augenblick glaubte ich, er würde in seinem Zorn mit einem einzigen Schlag sämtliche Steine vom Brett fegen. Dann hätte er seine Niederlage mit einer unrühmlichen Blamage gekrönt. Es gelang ihm jedoch, sich zusammen zu reißen. Wenn er schon untergehen musste, dann wenigstens mit Würde. Er stellte die Schachuhr ab, streckte seine feuchte, zittrige Hand Marion zu und sagte mit unsicherer Stimme:
„Ich gratuliere zu Ihrem Sieg.“
Die Spannung im Saal entlud sich spontan, schlagartig mit fast ohrenbetäubendem Lärm. Applaus, Hochrufe und Getrampel waren schwer auseinander zu halten. Der Schiedsrichter gab sich keine Mühe, vom Publikum Ruhe zu fordern. Niemand hätte auf ihn gehört. Er ging zu den Spielern, die jetzt ihre Partieformulare unterschrieben, und beglückwünschte Marion herzlich. Ohne mit Klatschen aufzuhören, standen die Wlassovs und ich auf und schritten zum Podium, denn wir wollten meiner Schwester auf der Stelle gratulieren. Als wir an Quintals Verwandten vorbeigingen, merkte ich, dass seine Eltern sich größte Mühe gaben, die junge Frau mit dem kupferfarbigen Haar zu beruhigen, da sie schien, gleich in Tränen auszubrechen.
Am Fuß der Treppe zum Podium mussten wir den Rektoren beider Universitäten den Vortritt lassen, so dass wir hinter ihnen aufs Podium gelangten. Marion und Quintal waren aufgestanden, und letzter, wohl wissend, dass der phantastische Begeisterungsausbruch seiner Rivalin galt, hielt sich jetzt ein paar Schritte zurück. So wie er da stand, kleinlaut und betreten, tat er mir beinahe Leid. Mir war klar, dass er sich am liebsten gleich in Luft aufgelöst hätte.
Professor del Río, restlos begeistert, ging auf Marion zu und umarmte sie, wobei er Gratulationsworte aussprach, die wir anderen wegen des Lärms kaum verstehen konnten. Danach näherte er sich Quintal und dankte ihm mit einem Händedruck, „dass er sich so tapfer geschlagen habe.“ Ihm folgte der Rektor der staatlichen Universität, Professor Francisco Moreno, von den Studenten wegen seiner untersetzten Gestalt und seines buschigen Schnurrbarts Pancho Villa genannt. Dann kamen wir an die Reihe. Marion strahlte, von der Gunst der Stunde fast überwältigt. Als sie mich sah, lächelte sie mich an.
„Großartig, Marion! Du warst einfach großartig!“ sagte ich ihr.
„Danke, Nico, danke!!“ erwiderte sie. Und als ich sie umarmte und küsste, sah ich, dass ihre Augen von Tränen glänzten. Ich musste dann an den putzigen Dreikäsehoch denken, der sich vor ca. zwanzig Jahren unermesslich freute immer wenn er sein drei Jahre älteres Brüderchen Matt setzte.
Während meine Schwester jetzt von Norma Wlassov und ihrem Vater gratuliert wurde, trat Rektor del Río vor das Mikrophon und wartete darauf, dass der Tumult verebbe. Noch gute zwei Minuten musste er sich gedulden.
„Meine Damen und Herren, liebe Schachfreunde!“, sagte er als wieder Stille herrschte. „Bei allem Verständnis für eure Begeisterung bitte ich euch, damit noch bis zur Siegerehrung zu warten. Wir müssen einige kleine Vorbereitungen treffen. Habt noch etwas Geduld.“
Der Rektor Professor Moreno, Don Fermín Marroig, die Wlassovs und ich verließen das Podium und machten es uns wieder auf unseren Plätzen in der vorderen Reihe bequem. Professor del Río blieb auf der Bühne, um ein paar Anweisungen zu geben. Einige Saaldiener kamen, stellten links und rechts große Blumenvasen mit Hortensien und Kamelien auf und installierten neben den Mikrophonständer einen kleinen Tisch mit dem Siegerpokal und einer Metallplatte darauf. Aus einem Nebenraum hörten wir ein leises Klirren von Gläsern und Porzellan.
Nach wenigen Minuten waren die Vorbereitungen beendet und die Siegerehrung konnte beginnen. Marion und Quintal standen jetzt neben dem Schachtisch. Auf ein Nicken vom Rektor del Río bestieg der Oberbürgermeister Don Estanislao Soto das Podium und ergriff das Wort. In seiner Ansprache lobte er zuerst die Leistung und die Fairness der beiden Finalisten „welche dem Publikum eine interessante und äußerst spannende Schachpartie geboten hatten.“ Dann drückte er seine Freude über das einmalige Ereignis aus, dass „der Sieger dieses Mal eine Siegerin ist: unsere in den Schachkreisen der Stadt bekannte Studentin Marion Kamp.“ Damit nahm er den großen Siegerpokal vom Tisch und begleitet von einem Saaldiener, der einen prächtigen Blumenkranz und das Mikrophon trug, näherte er sich Marion, die lächelnd auf ihn wartete.
„Wertes Fräulein Kamp“, sagte er zu ihr. „Es ist mir eine Freude, Ihnen zu ihrer großartigen Leistung zu gratulieren und im Namen des Stadtrates den Siegerpokal als diesjähriger Meisterin vom Universitätsklassiker zu übergeben.“
Mit diesen Worten, unter erneuten Hochrufen, donnerndem Applaus und den Blitzlichten der Fotoreporter, reichte er Marion den Pokal, hängte den Blumenkranz um ihren Hals und schüttelte herzlich ihre Hand. Meine Schwester wusste, was man jetzt von ihr erwartete. Sie nahm das Mikrophon aus der Hand des Assistenten und wartete bis der Applaus aufhörte, was bald geschah, denn alle waren gespannt auf ihre Worte. Man konnte merken, dass sie sichtlich bewegt war.
„Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister“, fing sie an, „lieber Herr Rektor del Río, verehrte Gäste, liebe Schachfreunde: Ihnen allen danke ich herzlich! Ich bin überglücklich, dass ich dieses Mal Siegerin des Universitätsklassikers werden konnte. Mein Dank gilt hauptsächlich all denjenigen, die mir zu diesem Sieg verholfen haben. Doch ganz besonders freue ich mich darüber, dass es mir gelungen ist, den Pokal nach vielen Jahren wieder zur technischen Universität zurückzuholen. Nochmals vielen Dank! Ich liebe euch alle!“
Und dass das Publikum nach diesen Worten nochmals außer Rand und Band geriet, braucht nicht erwähnt zu werden.
Quintal hatte sich wieder etwas gefasst. Auch für den Verlierer hatte der Oberbürgermeister einen Preis, nämlich eine kleine, runde Metallplatte mit eingravierten Datum und Ereignis, welche er Quintal reichte, nachdem er diesen für „sein großartiges Spiel und für sein faires Verhalten“ gelobt hatte. Und auch Quintal bekam seinen Applaus, denn ein Teil des Publikums bestand aus seinen Anhängern.
Der Oberbürgermeister lobte anschließend die beiden Rektoren für ihre Förderung des Schachs unter den Studenten, „die viel zur Verbreitung des königlichen Spiels in unserer Nation beitrage.“ Danach sagte er, dass er noch eine erfreuliche Mitteilung habe, „nämlich, dass ein Schachmäzen in unserer Stadt, der nicht genannt werden wolle, versprochen habe, nächstes Jahr eine Übertragung des Finalisten-Zweikampfes ins Freie mit Menschen als Schachfiguren voll und ganz zu finanzieren.“ Diese Mitteilung hatte nochmaliges Getöse mit Hurrarufen und Getrampel zur Folge.
Inzwischen war es fast halb acht. Professor del Río hielt noch eine kurze Abschlussrede mit Anspielungen auf „die Völker verbindende Wirkung des königlichen Spiels“. Dann dankte er den Anwesenden für ihr Interesse und kündigte an, dass im Studentenkasino, zwei Gebäude weiter, ein kaltes Büffet „zu Studentenpreisen“ angerichtet worden sei; die Ehrengäste mögen sich im Nebenraum einfinden, wo ein Festmahl beim gemütlichen Beisammensein auf sie warte.
Währenddessen hatte sich das Orchester wieder aufgestellt. Der Dirigent schwang seinen Taktstock und mit den Klängen des Triumphmarsches von Händels Oratorium Judas Makkabäus – und was hätte besser zum freudigen Ereignis gepasst? – ging die Siegerehrung feierlich zu Ende.
Die Finalisten mit ihrem eigenen Gefolge zählten zu den Ehrengästen, sodass die Wlassovs und ich uns zur Gruppe der Damen und Herren gesellten, die sich lebhaft die Ereignisse des Tages kommentierend zum Nebenraum begaben. Dieser war festlich geschmückt und auf dem langen, für ungefähr zwanzig Personen gedeckten Tisch, waren die Plätze bereits mit Namenschildern gekennzeichnet. Den fröhlichen Verlauf des Banketts, dessen vorzügliches Essen und Trinken von kurzen, witzigen Reden begleitet wurde, werde ich im Detail nicht wiedergeben. Nur zwei kleine Zwischenfälle scheinen mir hier erwähnenswert: Obwohl Quintals Eltern am Bankett teilnahmen, blieben die Plätze von Quintal selbst und der rothaarigen jungen Frau unbesetzt. Seine Mutter sagte uns, dass ihr Sohn sich nach dem Abschlusskonzert unpässlich gefühlt und sich deshalb entschuldigt habe; seine Begleiterin sei mit ihm fortgegangen. Im Laufe des Abends fragte Oberbürgermeister Soto meine Schwester, welche Erklärung sie für ihren erstaunlichen Sieg über Quintal habe. Verschmitzt lächelnd erwiderte sie ihm:
„Ein wenig Glück gehört auch dazu!“
Wohlweislich wollte sie das Geheimnis ihrer skurrilen Schachstrategie nicht preisgeben.
Eines Tages, etwa ein Monat danach und kurz vor Weihnachten, rief mich Pereira an und teilte mir mit, dass Quintal in seinem Abschluss-Examen durchgefallen sei. Am Abend desselben Tages besuchte ich meine Schwester in ihrem Studentenheim und erzählte es ihr. Sie machte große Augen.
„Aber das ist unmöglich!“, rief sie. „Er ist von Anfang an ein vorbildlicher Student gewesen. Viele haben einen Abschluss mit suma cum laude von ihm erwartet!“
„Das ist auch mir bekannt. Aber ich kann mir den Grund für sein Scheitern erklären. Er hat seine Niederlage noch nicht überwunden.“
Marion senkte den Blick und schüttelte ratlos den Kopf.
„Das habe ich nicht gewollt“, murmelte sie.
„Mach’ dir keine großen Sorgen um ihn. Quintal ist ein heller Kopf. Nächstes Jahr kann er das Examen wiederholen und er wird es schaffen. Außerdem hat die Tatsache, dass er jetzt durchgefallen ist, auch etwas Positives für ihn.“
Marion machte wieder große Augen.
„Wieso das?“ fragte sie.
„In Zukunft wird er den Mund weniger voll nehmen.“

Juan Oyarzún, von Beruf Chemiker, beteiligte sich 1986 am Literaturwettbewerb „Walter-Serner-Preis“ vom Sender Freies Berlin mit seiner Kriminalerzählung Flucht mit Hindernissen, welche unter 207 eingereichten Sendungen preisgekrönt und zusammen mit drei anderen in der Sendung Pulp vom SFB vorgestellt wurde.
Außerdem ist er Verfasser mehrerer Fachartikel und eines Fachbuchs, das 1998 auf Deutsch und zwei Jahre später auf Englisch veröffentlicht wurde.
Seit seiner Versetzung in den Ruhestand ist er als unabhängiger Fachberater tätig.
Auf Karl-Online ist mit Unter Gewinnzwang eine weitere Kurzgeschichte von Juan Oyarzún zu finden.
Die Kontaktadresse des Autors lautet: thesla@web.de
