KOLUMNE
Die Karl-Kolumne ergänzt die Printausgabe des Karl. Die Kolumne präsentiert Rezensionen aktueller und alter Schachbücher, Betrachtungen über die Literatur, Kultur und Psychologie des Schachs und gelegentliche Kommentare zum aktuellen Schachgeschehen.
GET CARTER:
AUF DER SUCHE NACH EINEM BESTSELLERAUTOR
Von FM Johannes Fischer
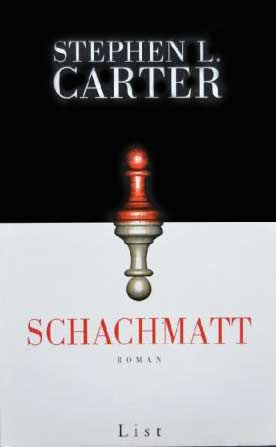
Stephen L. Carter,
Schachmatt,
München: List,
gebunden 24,00 Euro,
Taschenbuch 10,95 Euro
Schach lohnt sich offensichtlich doch. 4,2 Millionen Dollar erhielt Stephen L. Carter für seinen 2001 erschienenen Debütroman The Emperor of Ocean Park, dessen deutscher Titel Schachmatt lautet. Nachdem die gebundene Ausgabe Ende 2002 erschien, kam jetzt vor Kurzem die Taschenbuchversion heraus.

GETEILTE MEINUNGEN
Die Meinungen über Carters Debüt waren geteilt. Während Lorin Stein in der London Review of Books fand, das Buch sei „langatmig, schlampig zusammen geschustert und voller Wiederholungen und kleinen Ungereimtheiten“, war die New York Times euphorisch: „Mit Schachmatt ist Stephen L. Carter ein fesselnder Spannungsroman um Recht und Gerechtigkeit, Ehrgeiz und Liebe, politische Macht und menschliche Ohnmacht und nicht zuletzt ein literarisches Tableau der modernen Gesellschaft gelungen“. Und Deidre Donahue verstieg sich in USA-Today gar zu der Behauptung, es hätte „seit Tom Wolfe keinen so vielschichtigen, mitreißenden und bereichernden Roman mehr gegeben“. Auch John Grisham spendete Lob für den Kollegen: „Wunderbar erzählt und clever konstruiert. Schachmatt ist eine lebendige und vielschichtige Familiensaga, die geschickt verbunden ist mit der Spannung eines Thrillers … Ein wirklicher Genuss“.
DER GEWOLLTE BESTSELLER
Aber dieser positiven Kritik von renommierter Seite zum Trotz wirkt Schachmatt dennoch nur wie der misslungene Versuch, einen Bestseller zu fabrizieren. Mit 4,2 Millionen Dollar Autorenhonorar als Werbeetat – allein die Höhe der Summe garantiert Aufmerksamkeit. Und Stephen L. Carter, laut New York Times einer „der führenden Intellektuellen der Nation“ schien der ideale Autor für einen Bestseller auf Bestellung zu sein. Er ist Jurist, unterrichtet an der Yale-University und gehört der in den USA mit viel Aufmerksamkeit bedachten schwarzen Mittelschicht an. Carters Sachbücher, die sich mit Rassismus, dem amerikanischen Rechtssystem und Fragen christlicher Ethik in der Justiz beschäftigen, ließen erwarten, dass er auch in einem Roman christliche Moral, den Zustand der amerikanischen Gesellschaft und den allgemeinen Verfall der Werte zum Thema machen würde. Diese schöne Mischung erlaubte es Carters Roman als Justizthriller, als Campus-Roman und als Kommentar zu den Beziehungen zwischen Schwarz und Weiß zu verkaufen – ein brisantes Thema in populäre Genres verpackt.
LANGEWEILE
Es gibt nur ein Problem: Carter kann nicht erzählen. Seite um Seite langweilt er seine Leser mit immer neuen Charakteren, die für die Erzählung keine Bedeutung haben. Seine Figuren bleiben blass, seine Dialoge wirken gestelzt, seine Handlungsführung ungeschickt und steif. Immer wieder streut er Beschreibungen von Orten in den Text ein, die aus Reiseführern abgeschrieben sein könnten und deren Belanglosigkeiten den Roman endlos aufblähen ohne Sinn zu ergeben. Zur Abschreckung ein Beispiel unter vielen:
„Wir [der Ich-Erzähler Talcott Garland und sein Sohn Bentley] schlüpften in unsere Jacken und gingen die zwei Blocks vom Vinerd Howse bis zur Circuit Avenue, dem kommerziellen Herzen von Oak Bluffs. Auf ein paar hundert Metern sind dort all die Restaurants, Boutiquen und Läden voller Schnickschnack versammelt, die man in jedem Urlaubsort findet. Im Sommer wären wir in Mad Martha’s Eisdiele gegangen, um Vanillemilch und Erdbeereis zu bestellen, aber die ist den Winter über geschlossen. Deshalb gingen wir zu Murdicks Süßwarenladen (nach dem unvergleichlichen Flying Horses Bentleys zweitliebster Ort auf der Insel) und erstanden etwas Preiselbeeren-Fondant, eine Spezialität des Hauses. Danach schlenderten wir die Straße zurück. Im Eckladen kaufte ich noch die Vineyard Gazette, bevor wir bei Linda Jean’s einkehrten, einem beliebten Restaurant mit einfacher Ausstattung und bemerkenswert moderaten Preisen, das früher sogar das Lieblingslokal meines Vaters gewesen war (S.287-288)“.
Spannung kommt selten auf und wird meist in einem Konvolut von überflüssigen Personen, Reflektionen, Beschreibungen usw. erstickt. All das macht Schachmatt zu einem langweiligen, schlecht erzählten und belanglosem Roman. Dem deutschen Leser wird zudem noch eine Übersetzung voller Stilblüten und allzu wörtlicher Anlehnung an das Original zugemutet. Eine Liste solcher Stilblüten hat Jörg Seidel auf seiner Metachess Kolumne zusammengestellt.
DAS SCHACH
DIE STORY
Doch zur Story: Der Roman beginnt mit dem Tod Oliver Garlands, einem einst einflussreichen Richter, der beinahe an den Supreme Court gewählt worden wäre, jedoch einer Intrige zum Opfer fiel. Kurz nach dem Tod Garlands kommen auf dessen Sohn Talcott Probleme zu, denn finstere Gestalten glauben, dass Talcott über bestimmte Vorkehrungen Bescheid weiß, die der Richter getroffen und seinem Sohn vererbt hat. Talcott selbst hat keine Ahnung, was damit gemeint sein könnte, macht sich aber auf die Suche nach des Rätsels Lösung. Irgendwann stößt er auf eine kryptische Notiz seines Vaters, in der vom Exzelsior die Rede ist, einem Hilfsmattproblem. Dieses Schachproblem war Richter Garlands große Leidenschaft und er träumte davon, einen doppelten Exzelsior zu komponieren, ein Hilfsmatt mit beidseitiger Bauernumwandlung – nur wollte Garland, dass Schwarz gegen alle Gepflogenheiten des Problemschachs am Ende Matt setzt.
Dieses Schachproblem bildet die Leitschnur eines Racheplans des Richters, mit dem er sich an der Welt für das ihm widerfahrene Unrecht rächen will. Seine Vorkehrungen sind Aufzeichnungen über Gefälligkeitsurteile, die er zusammen mit einem anderen Richter gefällt hat – Material, das seine Korruption, aber auch die Korruption in der Justiz belegt.
Sohn Talcott ist nun in diesem Problem die Rolle eines Bauern zugedacht, der sich tapfer Schritt um Schritt nach vorne bewegt, bis er entdeckt, wo die geheimnisvollen Vorkehrungen versteckt sind, damit eine symbolische Unterverwandlung vollzieht und zu guter Letzt – so hatte es der Richter geplant – die Welt des weißen Establishments Matt setzen soll, indem er das brisante Material veröffentlicht.
Talcott taumelt wie ein tumber Tor durch die Handlung, entgeht dabei mehreren Anschlägen, findet aber zu guter Letzt und nach viel „Dramatik“ natürlich doch noch eine Diskette mit brisanten Aufzeichnungen. Allerdings bleibt auch bei dieser Entdeckung die Spannung aus, denn in charakteristischer Langatmigkeit fasst Talcott den Plot des Romans noch einmal zusammen, bevor er sich zur Rebellion gegen seinen toten Vater entschließt und der Roman endlich vorbei ist:
„Mein Vater hinterließ seinen doppelten Excelsior, nicht auf dem Brett, sondern im Leben, indem er zwei Bauern in Bewegung setzte, einen schwarzen, einen weißen, gleiche Züge im steten Wechsel …. Ein Springer starb. Der andere kann jetzt Schach bieten. Genau wie mein rachsüchtiger Vater es geplant hatte. Ich habe das Werkzeug dazu in der Hand. Ich muss nur den Hörer abnehmen … anrufen … und der doppelte Excelsior des Richters ist vollendet. Wobei jedoch die Aufgabe ‚gekocht‘ ist, falls irgendeine andere Möglichkeit offen steht. Und das Heikle an Springern ist, dass sie häufig … unberechenbar ziehen (S.850)“.
Kurz danach wirft Talcott die Diskette ins Feuer, um das Ansehen seiner Familie zu schützen und sich den Problemen der Gegenwart zu widmen.
SCHIEFE METAPHERN
Leider wirkt die schachliche Metaphorik bei näherem Hinsehen alles andere als überzeugend. Zwar gestattet sie dem Autor Kommentare über das ungleiche Verhältnis von Weiß und Schwarz und führt vor Augen, wie Oliver Garland seine Mitmenschen und seine Familie manipuliert hat. Aber Carters Konstruktionen überzeugen nicht. So soll das Schachspiel, in dem Schwarz von Beginn an benachteiligt ist, den gesellschaftlichen Kampf zwischen Schwarz und Weiß symbolisieren, aber gerade im Hilfsmattproblem ist dieser Antagonismus zwischen Schwarz und Weiß aufgehoben. Hier haben Weiß und Schwarz das gleiche Ziel und wenn eine Seite die andere am Ende Matt setzt, so haben beide ihren Teil geleistet und sind zufrieden. Und Züge im Hilfsmatt sind oft nur in dem Sinne forciert, dass sie die einzige Lösung der Aufgabe darstellen.
Aber trotz dieser und anderer Ungereimtheiten bleiben Carters Schachmetaphern aufschlussreich: Denn sie sind nicht nur schlecht übersetzt, sondern auch konstruiert und prätentios – wie der gesamte Roman.
—————————-
LINKS ZUM THEMA:
Jörg Seidels Kritik an Carters Roman
Auch Udo Harms war nicht begeistert
Eine Übersicht über die unterschiedlichen Rezensionen des Buches offeriert die Complete Reviews Webseite.
